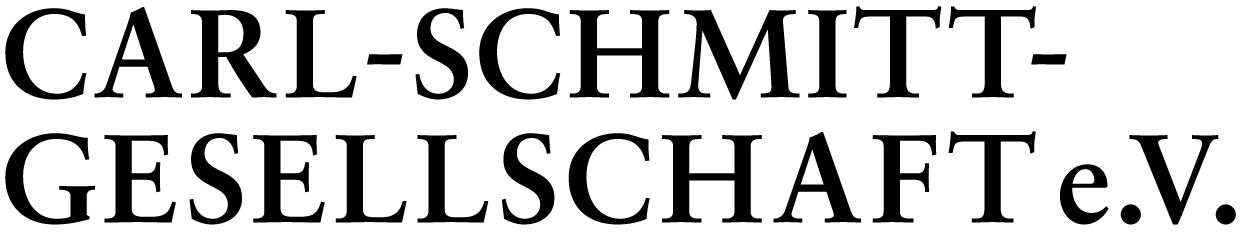Korrekturen und Ergänzungen
Korrekturen und Ergänzungen
Personenregister
Die Gesellschaft zeigt an dieser Stelle wichtige Korrekturen und Ergänzungen zur Carl-Schmitt-Literatur an, die anhand von Materialien aus dem Nachlass zusammengestellt werden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf edierten Primärquellen wie Tagebüchern, Briefsammlungen, Dokumenten und Büchern von Carl Schmitt, die von der Gesellschaft und ihren Mitgliedern herausgegeben wurden. Das schließt die Erstellung bisher fehlender Personenregister ein. Die Gesellschaft lädt die Forschergemeinschaft ein, ihr Korrekturen, Unklarheiten und Ergänzugen mitzuteilen. Berücksichtigt werden inhaltliche Fehler, formale nur, soweit sie den Inhalt berühren.
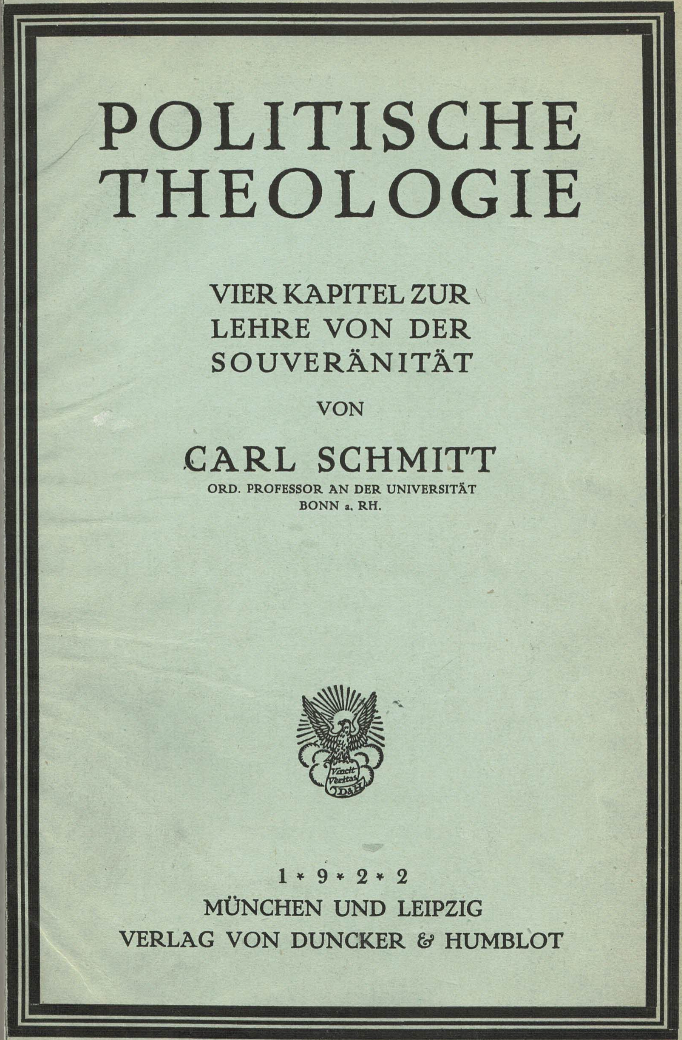
Politische Theologie
Die heute in 11. Auflage (Berlin 2021) vorliegende Fassung von Politische Theologie beruht auf dem Text der Ausgabe von 1934. Kleinere Teile aus der Version von 1922 sind nicht aufgenommen. Nachfolgend werden Änderungen und Auslassungen anhand der aktuellen 11. Auflage angeführt. Weitere Korrekturen und Ergänzungen sind zum „Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes“, zu den Tagebuch-Editionen und zu den veröffentlichten Briefwechseln zwischen Carl Schmitt mit Ernst Forsthoff und Armin Mohler.
Carl Schmitt, Politische Theologie, Duncker & Humblot, Berlin 2021
Nachfolgend werden die Änderungen und Auslassungen anhand der aktuellen 11. Auflage angeführt. Sie stehen nach der Angabe in der aktuellen Ausgabe.
Titelei. Der folgende Eintrag fehlt in der Neuauflage:
Auf der Seite gegenüber dem Haupttitel sind am unteren Ende folgende Zeilen gedruckt: Die vier Kapitel Politische Theologie sind – gleichzeitig mit einem Aufsatz über „Die politische Idee des Katholizismus“ – im März 1922 geschrieben. Das Buch von Le Fur, Races, Nationalités, États (Paris, Alcan, 1922) war damals noch nicht zugänglich.
S. 15, 7.Z.v.o: Wieweit statt wieweit
S.15, Absatz statt fortlaufender Text
S. 17, Absatz statt fortlaufender Text
S. 18, 7. und 6.Z.v.u.: Anarchie und Chaos
statt eine Anarchie und ein Chaos
S. 19, Der Absatz fehlt in der Erstauflage
S. 20, 13.Z.v.o.: nach „von selbst.“ Folgender Text wurde nicht übernommen: :
Darin, dass Erich Kaufmann, dessen bisherige Schriften eine zusammenhängende große Linierkennen lassen, in seiner „Clausulas rebus sic stantibus“ das Notrecht zum Angelpunkt seiner Darlegung macht, liegt eine elementare, organische Konsequent
S. 21, 2.Z.v.o. nach (Staatsrecht, S. 906). Folgender Text wurde nicht übernommen:
Daher scheint auch ein Rest Rationalismus darin zu liegen, wenn Erich Kaufmann die extremen Fälle vom Recht ausschließen will. Bei der Erörterung des Notstandsproblems erwähnt er den Fall, daß sich in beiderseitiger Lebensgefahr zwei Notrechte gegenüberstehen und jedesmal die Tötung des einen durch den anderen rechtmäßig sein kann; dazu bemerkt er: »Das Recht kann mit seinen Normierungen solche extremen Fälle nicht rationalisieren und regIementieren wollen, sondern muß sich vor solchen Schicksalen scheu zurückziehen und weder Ersatz noch Strafe an sie knüpfen« (Clausula, S. 121. VgL Untersuchungsausschuß, S. 77). Er spricht in diesem Satz nur von dem Notstand, der zwei private Individuen oder zwei Staaten als völkerrechtliche Subjekte trifft. Wie aber, wenn innerhalb des Staates ein extremer Notstand eintritt, müßte dann nicht gerade der Notfall das Wesen der staatlichen Ordnung offenbaren? Kaufmann zitiert an dieser Stelle einen Satz aus Hegels Rechtsphilosophie (§ 128): Die Not offenbart sowohl die Endlichkeit als die Zufälligkeit des Rechts. Dazu ist zu sagen, daß sie gleichzeitig die Bedeutung des Staates offenbart und daß der Staat ebenfalls Gegenstand juristischen Interesses bleiben muß.
S. 25, Ende erster Absatz. Folgender Text wurde nicht übernommen:
An dem, was an neuer staatsrechtlicher Literatur in den letzten Jahren in Deutschland ver-öffentlicht wurde, läßt sich nicht erkennen, daß die theoretischen Interessen schon jenen Grad der Intensität erreicht hätten, der zu einer klaren Antithese und einem präzisen Begriffe führt. Nicht einmal das allgemeine Interesse des juristischen Publikums scheint groß genug zu sein. So ist es wohl zu erklären, daß eine so auffällige Schrift, wie die Kritik der neu-kantischen Rechtsphilosophie von Erich Kaufmann, von der Masse der gebildeten Juristen mit einer Harmlosigkeit aufgenommen wurde, als handele es sich wieder einmal um eine der vielen erkenntnistheoretischen und methodologischen Spiegelfechtereien. Wolzendorff hat genug wissenschaftliches Temperament, um das Bedürfnis nach einer geistigen Klärung auszusprechen und zu verlangen, daß eine neue Staatsidee die Wurzel einer neuen Staatlichkeit sein müsse. Aber während die Veröffentlichung von Erich Kaufmann bisher im Kritischen geblieben ist und eine weitere positive Darlegung seiner Staatslehre abgewartet werden muß, liegt bei Wolzendorff nur ein Programm mitzahlreichen Aperçus vor. Das ungeheure sozio-logische Material der Schriften Max Webers für die juristische Begriffsbildung zu verwerten, ist bisher, noch nicht versucht worden.
S. 29, Ende des ersten Absatzes. Folgender Text wurde nicht aufgenommen:
…, und Erich Kaufmann (in seiner Kritik der neukantianischen Rechtsphilosophie) tut ihnen zu viel Ehre an, wenn er von der Eindimensionalität dieser Art zu denken spricht; bisher ist es bei dem Programm einer solchen Eindimensionalität geblieben.
S. 34, Ende des ersten Absatzes. Folgender Text wurde nicht aufgenommen:
Daß es sich heute um die Form in einem substanziellen Sinne, nicht um die apriorische leere Möglichkeit der neukantischen Rechtsphilosophie handelt, wird an Erich Kaufmanns »Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie« (Tübingen 1921) deutlich. Kaufmann betont mit Recht, daß der Gegensatz von Form und Inhalt als bloß begrifflicher Gegenstand notwendig relativ ist und einem bestimmten relativen Erkenntniszwecke dient, daß also jedes Element als Form erscheinen kann. Der Neukantianismus, der im Gegensatz zu Kant nur Erkenntnistheorie, nicht Metaphysik sein will, läßt mit seiner aus erkenntnistheoretischen Gründen vorgenommen Trennung von Form und Inhalt den herrschenden empirischen Realismus ungestört bestehen. Diese merkwürdige Erscheinung, daß der transzendentale Idealismus sich mit dem plattesten Positivismus verbinden kann und diese ganze Rechtsphilosophie, trotz ihrer pathetischen Unbedingtheit und Reinheit, doch immer bei dem gewöhnlichen Empirismus endet, erklärt Kaufmann daraus, daß sie darauf verzichtet, die Wirklichkeit des Lebens zu erfassen, und glaubt, ungestraft den Naturbegriff, den metaphysischen Boden, aufgeben zu können, auf dem bei Kant Wert und Wirklichkeit sich wieder vereinigen. In der Staatsrechtslehre entspricht der Positivismus der Labandschen Schule und deren konstruktiver Formalismus jenen Tendenzen der neukantischen Rechts-philosophie, die alle historischen und soziologischen Gegebenheiten und Gestaltungen, aus denen das Recht herausgewachsen ist, als meta-juristisch, außerhalb des juristischen Begriffes verweist und nach dem alten rationalistischen Vorurteil eine substanzlose, eindimensionale Einfachheit als das methodisch, oft sogar metaphysisch und ethisch Wertvolle hypostasiert. Ein solcher Rationalismus ist wehrlos gegen jede ihm entgegen-tretende Metaphysik, gegen die geistloseste Geschichts-psychologie und gegen die Geschichtsphilosophie des ökono-mischen Materialismus. Er gibt den metaphysischen Interessen der Zeit nichts und hat nicht einmal das, was den alten Rationalismus zu einer großen Metaphysik gemacht hatte, nämlich den Glauben an die Rationalität der empirischen Wirklichkeit, an die unendliche Perfektibilität des Menschen und den ewigen Fortschritt in der Geschichte.
Auch diese Kritik des neukantischen Rationalismus endet bei dem Problem der Form. Nachdem, mit Recht, gegen den neukantischen Formalismus die Relativität der Begriffe von Form und Inhalt geltend gemacht wurde (S. 37), lautet der Schluß: die neukantische, ratio-nalistische, metaphysikfreue Erkenntnistheorie vermag das herandrängende Leben nicht zu bändigen, dem Chaos keine Ordnung zu geben. Darin soll eine große Gefahr liegen. »Denn
wir bedürfen, um leben zu können, der Formen. Aber nur die lebendige Form ermöglicht das Leben, und nur sie teilt das Schicksal des Lebens, sterben zu können. Die abstrakte, nur durch rationales Denken gewonnene Form aber ist hart und starr, und sie kann nicht sterben, weil sie tot ist.«
Ist das die goldene Mitte zwischen den zwei Extremen Formalismus und Nihilismus und nur eine Wiederholung jener alten Antithesen von lebendig und tot, organisch und mechanisch usw.? Kaufmann hat bisher eine Darstellung einer Lebens- oder Irrationalitäts-philosophie nicht gegeben. Aber trotzdem seine Schrift wesentlich kritisch ist, und trotz ihrer aphoristischen Art, in der manche Sätze wie komprimierte Monographien erscheinen, ist sie unter den Veröffentlichungen, die von Juristen ausgehen, bisher die einzige intensive Äußerung einer neuen geistigen Intensität und einer neuen recherche de la réalité. Max Weber, der im Vergleich zu Erich Kaufmann ein Rationalist ist, wenn auch ein sehr substanzieller Rationalist, hatte schon lange vor den leeren Selbstverständlichkeiten der Stammlerschen Rechtslehre die Geduld verloren. Von einer ganz anderen geistigen Haltung her versucht jetzt ein Jurist zum Thema, das heißt zum Staat, zu kommen. Die neukantische
Rechtsphilosophie hat immer nur vom Recht, nicht vom Staat gesprochen, und der einzige systematische Versuch, das Souveränitätsproblem zu bewältigen, endete bei Kelsen damit, daß er keinen Unterschied zwischen Staat und Recht sah und den Staat mit der Rechts-ordnung identifizierte. Kaufmanns Schrift konnte daher, solange sie wesentlich kritisch bleiben wollte, nicht eine eigentliche Souveränitätslehre geben. Aber jedenfalls muß die
Philosophie vorn Leben, zu der er sich bekennt, den Staat als real existierende Größe in einer ähnlichen Weise in den Mittelpunkt ihres Interesses stellen, wie die neukantische Rechtsphilosophie das Recht als geltende Ordnung. Angesichts der automatischen und simplistischen Disjunktionen, die heute in der sogenannten methodologischen Diskussion herrschen, ist zu befürchten, daß der Staatstheorie Erich Kaufmanns mit mechanischer
Selbstverständlichkeit das Wort Soziologie entgegengehalten wird und daß man über den normativen Charakter der Jurisprudenz zu belehren versucht. In Wahrheit ist Kaufmann, soviel sich aus seinen bisherigen Schriften entnehmen läßt, nicht wesentlich Soziologe, sondern Geschichtsphilosoph. In seinem Werk über die clausula rebus sic stantibus hat der Staat die Fülle seines Lebens in der Geschichte und ihrem ewigen Werden. Freilich zeigen
sich hier noch rationalistische Momente. »Die letzte Berechtigung,« heißt es zum Beispiel
(S. 145), „kann der Rechtszwang nur daraus schöpfen, daß die zwingende Gemeinschaft richtige Ziele verfolgt«. Eine solche Frage nach der inhaltlichen Richtigkeit und der Berechtigung des Zwanges ist rationalistisch. Von der konkreten Gemeinschaft aus müßte man zuerst nicht nach dem Inhalt des Zweckes und dem Inhalt des Zwanges, sondern danach fragen, wer es ist, der einen zwingt. Der Wert der staatlichen Gemeinschaft liegt nach diesem
Buche Kaufmanns darin, daß sie alle individuellen Kräfte sammelt und zu einem Gesamtplan des menschlichen Kulturlebens zusammenordnet, »um diesen in den Gang der Weltgeschichte einzufädeln«. Wie weit gibt er nun eine nicht-rationalistische Geschichtsphilosophie? Der Rationalismus des Hegelschen System, der in der Schrift über die clausula rebus sic stantibus nachwirkt, ist nur ein besonders kühner Rationalismus, weil er auch vor der Geschichte nicht zurückschreckt. In der Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie dagegen und in den letzten Aufsätzen Kaufmanns (Untersuchungsausschuß und Staatsgerichtshof, Berlin 1920 sowie dem meisterhaften kleinen Aufsatz über die Regierungsbildung im Deutschen Reiche und Preußen, Westmark 1921, Heft 3) kommt gelegentlich ein entschiedener Irrationalismus zum
Ausdruck, wenn auch nur in polemischen Wendungen. Er geht nicht so weit wie Georges Sorel, der die Formen des politischen Lebens und des staatstheoretischen Denkens nur als eine Art Zeichen und Fahnen auffaßt, die über dem Meere der irrationalen Wirklichkeit schweben, ohne inhaltlich einen adäquaten Zusammenhang mit der Sache zu enthalten. Die wabre Form soll vielmehr aus den immanenten Gesetzen des Stoffes abgelesen werden. Immer wird davor gewarnt, »den der rechtlichen Rationalisierung entzogenen Bestand von Irrationalitäten zu vergewaltigen.«
Die Struktur seiner Argumentation, die politische Anschauung, die philosophische Sicherheit, das ihm zur Verfügung stehende Material, alles das bringt Kaufmann in den größten Gegensatz zu Wolzendorff. Daß beide von Gierkes Genossenschaftstheorie herkommen, zeigt, daß eine solche Theorie mehr als eine einzige politische und juristische Konklusion tragen kann und sich überdies mit einer entgegengesetzten Metaphysik zu verbinden vermag. Wolzendorff bleibt immer humanitär, fortschrittsgläubig; er gehört, trotz
seiner Genossenschaftstheorie, nach seiner Lebensauffassung wesentlich ins 18. Jahrhundert. In seiner Bewunderung für Condorcet zeigt sich das am schönsten. Für einen konsequenten Philosophen des konkreten Lebens darf es kein Einwand sein, daß die Äußerungen Wolzendorffs gelegentlich widerspruchsvoll und ganz skizzenhaft geblieben sind; auch in der Unbeholfenheit und Skizzenhaftigkeit kann sich eine starke vitale Kraft äußern. Kaufmann wird es sich daher gefallen lassen müssen, daß man ihn mit Wolzendorff vergleicht. Dabei ergibt sich, daß beide trotz aller Verschiedenheit zu der Forderung einer »Form« gelangen. Gierke konnte noch davon sprechen, daß der Staat eine »nur äußerlich formale« Tätigkeit ausübt. Für Wolzendorff hat der Staat gerade als Form seinen Wert und verleiht er einer formlosen, ungestalteten Materie einen Wert. Kaufmann schließt seine Kritik der neukantischen Rechtsphilosophie mit der Forderung einer »lebendigen Form«.
S. 45, 2.Z.v.o. kein Absatz in der Erstauflage; dort Absatz nach der 4.Z.v.o, Mitte
S. 45, 21.Z.v.o. nach …begnügt wurde folgender Text nicht übernommen:
Namentlich gegen Labands Staatslehre sind solche Einwendngen erhoben worden, die in einem gewissen Widerspruch stehen zu dem Vorwurf, den Erich Kaufmann der Labamdschen Schule macht, wenn er sagt, es mangele ihr an jeder metaphysischen Fundierung
S. 46, letzte Zeile und S. 47, erste Zeile:
„…„auf der Verwerfung aller ‚Willkür und auch jede Ausnahme aus dem Bereich des menschlichen Geistes zu verweisen.“ statt … auf der Verwerfung aller ‚Willkür:, die jede Ausnahme aus dem Bereich des menschlichen Geistes zu verweisen sucht“.
S. 55, 4.Z.v.o. Folgender Text wurde ncht übernommen;
Die letzte systematische Gestaltung einer theistischen Staatslehre ist Stahls Rechtsphilosophie.
S. 60, 5.Z.v.o. und 14. Z.v.o.: Bonald statt ihn bzw.er
S. 65, 4.Z.v.u.: Donoso statt Cortés
S. 66, 18.Z.v.u.: Donoso statt Cortés
S. 67, 4.Z.v.o. und 15.Z.v.u.: Donoso statt Cortés
S. 67, 2.Z.v.u.: moralisierender statt moralistischer
S. 68, 15.Z.v.u.: Donoso statt Cortés
S. 69, Der Absatz fehlt in der Erstauflage
Carl Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines Politischen Symbols. Mit einem Anhang und einem Nachwort des Herausgebers. 5. Auflage. Klett-Cotta, Stuttgart 2015
Die Errata-Liste enthält sowohl die in der aktuellen Auflage auf S. 135 und 136 angeführten Korrekturen und Ergänzungen als auch die in den Handexemplaren des Autors angegebenen. Die Exemplare im Nachlass Cal Schmitts, Landesarchiv NRW, Abtlg. Rheinland, haben die Signaturen LAV NRW RW 265 Nr. 27453 und Nr. 27463.
Seite 7, Übersicht, Kapitel 3., statt: er ist zugleich eine repräsentativ-souveräne Person und eine große Maschine – lies: er ist eine repräsentativ-souveräne Person und zugleich eine große Maschine
Seite 18, 8. Zeile, statt: Daher essen sie – lies: Daher essen die Juden
Seite 18, vorletzte und letzte Zeile, statt: Hobbes in einem völlig neuen Licht erscheinen läßt. Da nämlich der Leviathan auch eine Schlange – lies: Thomas Hobbes in einem völlig neuen Licht erscheinen läßt. Der Leviathan ist auch eine Schlange
Seite 25, 6. Zeile von unten, statt: einer friedlichen Stadt – lies: einer friedlichen, aber gut befestigten Stadt
Seite 33, 13. Zeile, statt: Dagegen hat Hobbes in – lies: Dagegen findet sich in
Seite 33, 15. Zeile, statt: gegen Bramhall bemerkt –lies: gegen Bramhall die Bemerkung
Seite 34, 7. Zeile von unten und Seite 35, Anmerkung 1, statt: C. E. Vaugham – lies: G.M. Vaughan
Seite 35, 4. und 5. Zeile, statt: daß er, als ein wirksames Bibelzitat, die – lies: dass ein wirksames Bibelzitat die
Seite 38, Anmerkung 1, statt: Praeadamitae, quibus – lies: Praeadamitae sive exercitatio super vers. 12,13,14, cap. V. Epistolae D. Pauli ad Romanos, quibus
Seite 38, Anmerkung 1, statt: Thomasius – lies: Thomasius der Ältere [Jakob Thomasius]
Seite 38, Anmerkung 1, statt: 1931 – lies: 1930
Seite 42, 7. Zeile von unten, statt: Barbadoes-Inseln – lies: Barbados-Inseln
Seite 44, Anmerkung 2, statt: la crise – lies: La Crise
Seite 57, 8. Zeile von unten und Anmerkung 1, statt: Thermitenwahn – lies: Termitenwahn
Seite 57, letzte Zeile, statt: Thermiten – lies: Termiten
Seite 57, Anmerkung 1, statt: Karl Escherich – lies: Carl Escherich
Seite 58, 5. Zeile, statt: Thermiten – lies: Termiten
Seite 61, 3. Zeile von unten: statt: jetzt seelenlose – lies: jetzt seit Ende des 18. Jahrhunderts seelenlose
Seite 64, Anmerkung 1, statt: München 1931 – lies: München 1932
Seite 67, 12 bis 15.Zeile, statt: Wenn Friedrich der Große in seinem politischen Testament von 1752 sagt: Je suis neutre entre Rome et Genève, so ist das angesichts der damaligen Vollkommenheit des preußischen Staates – lies: Friedrich der Große sagt in seinem politischen Testament von 1752: Je suis neutre entre Rome et Genève. Das ist das angesichts der damaligen Perfektion des preußischen Staates
Seite 70, 5. Zeile, statt: herausgebildet – lies: vollendet
Seite 72, 4. Zeile, statt: macht – lies: setzt
Seite 75, 6. Zeile, statt: Denn erst der – lies: Erst der
Seite 78, 8. Zeile von oben, statt: Man – lies: André Malraux
Seite 82, Anmerkung, statt: Distichon von Saint-Médard – lies: Distichon von Konvulsionären von Saint-Médard
Seite 84, 11. Zeile, statt: privat – lies: private
Seite 88, 6. Zeile, statt: eine Staatsreligion heran – lies: die Staatsreligion eines christlichen Volkes heran
Seite 88, Anmerkung 1, statt he hat – lies: he had
Seite 89, 10. und 11. Zeile von unten, statt: Trennung und Antithese weitergetrieben werden. Durch Pufendorff – lies: Trennungen und Antithesen weitergetrieben werden. Durch Pufendorf
Seite 91, 8. Zeile, statt: Variationen – lies: Varianten
Seite 91, 9. und 8. Zeile von unten, statt: Goethes Straßburger, das Verhältnis von Kirche und Staat betreffende Dissertation geworden. – lies: Goethes Straßburger Dissertation, die das Verhältnis von Kirche und Staat betrifft.
Seite 95, 11. Zeile von unten, statt: Sicherheit – lies: Gewißheit
Seite 100, 3. und 4. Zeile, statt: Der Staat selbst aber verwandelt sich – lies: Der Staat selbst verwandelt sich
Seite 103, 10. und 11. Zeile, statt: so folgerichtig und systematisch zu Ende gedacht, daß – lies: so folgerichtig wie systematisch zu Ende gedacht, so daß
Seite 104, 9. Zeile, statt: gründen – lies: gründet
Seite 111, Anmerkung 2, statt: Dürckheim – lies: Durkheim
Seite 112, 6. Zeile, statt: wenn ihr ganzer – lies: deren ganzer
Seite 115, 6. Zeile, statt: der – lies: Anselm Feuerbach
Seite 115, 7. Zeile, statt: das Strafgesetz zu dem gemacht hat, was – lies: in dem das Strafgesetz zu dem gemacht wurde, was
Seite 116, 3. Zeile von unten, statt: Mächte – lies: Kräfte
Seite 117, 1. Zeile, statt: vor ihre Fahrzeuge gespannt – lies: vor die Fahrzeuge ihrer Interpretation gespannt
Seite 122, 13. Zeile von unten, statt: unproblematische – lies: problemlose
Seite 129, letzte Zeile und S. 130, erste Zeile, statt: Hobbes ist weder ein Mythologe noch selber ein Mythos. Nur mit seinem Bild vom Leviathan hat er sich – lies: Hobbes ist weder ein Mythologe, wie Vico es war, noch selber ein Mythos, wie es Machiavelli wurde. Nur mit dem Bild vom Leviathan hat Hobbes sich
Seite [143], 13. Zeile, statt: Blickfang – lies: Emblem
Seite [153], Anmerkung 1, statt: eines Atheisten wendet. – lies: eines Atheisten wendet. (S. 44).
Seite [155}, 4.Zeile von unten, statt: Pufendorff – lies: Pufendorf
Seite [167], 3. Zeile von unter, statt: Schilderungen – lies: Schilderung
Seite [176], 7. Zeile von unten, statt: Salesberiensis – lies: Salisberiensis
Seite [204), 2. Zeile, statt: hier Erik – lies: hier mit Erik
Seite [204], 3. Zeile, statt: folgt – lies: übereinstimmt
Carl Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes
Personenregister des Haupttextes (S. 1-132)
Aesop 77
Ammianus Marcellinus 19
Atger, Frédéric 52
Aubrey, John 88
Bacon, Francis 48, 55
Bail 17
Baudissin, Wolf 12
Bedford, Jasper Tudor, Duke of 41
Beyerhaus, Gisbert 49, 90
Bezold, Friedrich von 37
Bloch, Marc 81
Bluntschli, Johann Caspar 90
Bodin, Jean 17, 37, 49, 66, 68
Börne, Ludwig 108
Bonwetsch, Gottlieb Nathanael 11, 49
Bosch, Hieronymus 40
Bramhall, John 50, 86
Brockdorff, Cay von 5
Browne, John 81
Breughel, Pieter (d. Ä.) 40
Breughel, Pieter (d. J.) 40
Buddeberg, Karl Theodor 49
Burke, Edmund 41
Cahier, Charles 14, 15, 45
Calvin, Jean 49
Campanella, Tommaso 36, 70, 78
Capitant, René 112, 113
Carlyle, Thomas 34
Churchill, Winston 77
Codurcus, Philipp 38, 39
Cologna, Abraham de 17
Comte, Auguste 111
Conde, Francisco Javier 68
Condorcet, Nicolas de 54, 56, 61
Cromwell, Oliver 119
Crooke, Andrew 26
Dante Alighieri 41
Daskalakis, George 68, 112
Dekker, Thomas 41
Delitzsch, Friedrich 11
Descartes, René 44, 59
Devonshire, Lord 88
Diderot. Denis 5
Durkheim, Émile 111
Eisenmenger, Johann Andreas 17
Emge, Carl August 22, 76, 77
Ephraim, Syrus 14
Erastus, Thomas 65, 66
Erich, Oswald 13
Escherich, Carl 57, 56
Feuerbach, Anselm 114, 115, 116
Feuerbach, Ludwig 114
Fichte, Johann Gottlieb 129
Figgis, John Neville 50, 65, 99, 117
Fischer, Hugo 53
Freyer, Hans 76, 77, 130
Friedrich II., König von Preußen 67, 90
Gehlen, Arnold 5
Gerhardt, Paul 95
Giehlow, Karl 45
Goethe, Johann Wolfgang von 91
Gougenot des Mousseaux, Henri Roger 12
Gregor I., Papst 15
Gregor von Nyssa 15
Grotius, Hugo 107
Guénon, René 44
Gueydan de Roussel, William 64
Gunkel, Hermann 11
Hamann, Johann Georg 93, 107, 116, 123
Harnack, Adolf von 125
Harold II., König von England 19
Hauck, Albert 12
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 9, 47, 129, 130
Heine, Heinrich 108
Hennings, Herbert 116
Herder, Johann Gottfried 129
Herrad von Landsberg 15
Hippel, Robert von 116
Hirsch, Hans 83
Hobbes, Thomas 5, 6, 9, 10, 18, 20-23, 25, 30-35, 42, 43, 48, 50, 54-59, 61, 62, 65, 66, 68-72, 79-91, 93, 96, 97, 103-105, 107, 110-116, 119-124, 126, 127, 129, 130-132
Homeyer, Anna 109
Hooker, Richard 50
Jakob I., König von England 54
Jerusalem, Franz. W. 52, 111
Jünger, Ernst 124
Julian Apostata 19
Kant, Immanuel 61, 90, 123
Karl II., englischer König 81
Knabenbauer, Joseph 11
König, Johann Friedrich 11
Konstantin der Große 20
Ladner, Gerhard 83
La Fontaine, Jean de 77
Laird, John 35, 88
La Mettrie, Julien Offray de 59
Landry, Bernard 52
Leo I., Papst 15
Leroy, Maxime 44
Lidzbarski, Max 14
Ligons, Richard 42
Locke, John 42, 43, 90, 110, 112, 116
Ludwig XIV. 49, franz. König
Luther, Martin 12, 16, 17, 36, 37, 39, 95
Mach, Ernst 62
Machiavelli, Niccoló 22, 78, 127-131
Malraux, André 78
Mandeville, Bernard de 43
Marlowe, Christopher 40
Marsilius von Padua 99
Martin, Arthur 14, 15, 45
Marx, Karl 108
McIlwain, Charles Howard 66, 68
Mendelssohn, Moses 92-94, 108, 110
Meyer, Herbert 19
Meyerbeer, Giacomo 108
Milton, John 41
Mohl, Robert von 106
Montesquieu, Charles de 116
Nero, röm. Kaiser 94
Neuss, Wilhelm 13
Nietzsche, Friedrich 10, 22
Obendiek, Harmannus 16, 37
Opicinius de Canistris 14
Partridge, Eric 42
Passerin d‘ Entrèves, Alexandre 50, 65, 66, 100
Peterson, Erik 14
Peyrére, Isaac de La 38
Platon 10
Preuschen, Erwin 11
Pufendorf, Samuel von 89
Quincey, Thomas De 42
Radbruch, Gustav 114
Reland, Adrian 17
Ritterbusch, Paul 34, 35, 51
Rothschild (Brüder) 108
Rousseau, Jean-Jacques 105
Salomon, Richard 14
Sanderson, Robert 41
Sauer, Joseph 16
Schaffstein, Friedrich 115
Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph 61
Schelsky, Helmut 22, 30, 43, 127
Schiller, Friedrich 129
Schirmer, Walter 43
Schmitt, Otto 13
Schramm, Percy Ernst 81
Schweinichen, Otto von 101, 102
Seeberg, Richard 15, 49
Seneca 94
Shakespeare, William 40, 95
Sorel, Georges 22
Spinoza, Baruch de 21, 38, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 107, 108, 110
Stahl-Jolson, Friedrich Julius 106-109
Steinbömer, Gustav 67
Stephen, Leslie 43Strabo, Walafrid 15
Strauss, Leo 20, 21, 38
Swedenborg, Emanuel 41
Thomasius, Christian 89, 90, 107, 111
Thomasius, Jakob 38
Tönnies, Ferdinand 35, 43, 44, 88, 103, 104
Torczyner, Harry 11
Vaughan, Geoffrey M. 34, 35
Vialatoux, Joseph 50, 52, 111, 112
Vico, Giambattista 22, 127
Voigt, Oskar 107
Voltaire 82
Voß, Christian Friedrich 59
Walz, Gustav Adolf 111
Weber, Max 101, 110
Weitzmann, Kurt 13
Wilhelm der Eroberer 19
Wilkens, Cornelius August 109
Willms, Hans 10
Wilson, Woodrow 129
Wolff, Christian 91
Wycliff, John 36
Zellinger, Johannes 16
Zschokke, Heinrich 16
Carl Schmitt: Glossarium. Aufzeichnungen aus den Jahren 1947 bis 1958. Erweiterte, berichtigte und kommentierte Neuausgabe, hrsg. von Gerd Giesler und Martin Tielke. Duncker & Humblot, Berlin 2015.
S. 73, Z. 11 v.u.: nicht „bestanden“, sondern „be[i]standen“.
S. 172, Z. 8 v.o.: nicht „Danzenbrinck“, sondern „Danzebrink“ (ebenso S. 466 u. Reg.).
S. 275, letzte Z.: nicht „Lurche“, sondern „Lerche“.
S. 277 neue Legende: Zeitungsausschnitt vom 2.6.1952 eingeklebt. Darüber: „2. Juni 1952.“ Links teilw. in Steno: „Am gleichen Tag auch erfahren, Ernst Robert Curtius erhält den […] p. l. mérite! 1954 [1959?] Einige Zeit später: erfahren, dass der Arme einen Schlaganfall erlitten hat und nicht mehr sprechen kann.“
S. 281, 5. Z. v.u.: nicht „den richtigen Anfang“, sondern „den richtigen Ansatz“.
S. 309, FN 1: nicht „2.1.55“ sondern „12.1.55“.
S. 366 zu 6.10.57: nicht „Connaisseur“ sondern „Connoisseur“.
S. 390, Mitte: nicht „Schulmeister Jul. Schering“, sondern „Schulmeister Jul. Schwering“.
S. 407 zu 7.9.47 einfügen: Paul Adams kannte die Stelle… – In der deutschen Übersetzung (Léon Bloy, Der undankbare Bettler, Nürnberg 1949, S. 194, Tagebuch-Eintrag vom 22.6.1894) lautet sie: „An eine junge nordische Katholikin, die ihr Herz an einen konvertierten Juden verloren hat: ›Ich kann Sie leider zu Ihrer Wahl nicht beglückwünschen, armes Mädchen. Von allem Anfang an wurde die jüdische Rasse von den übrigen Menschenrassen getrennt, und zwar so scharf getrennt und so ausdrücklich letzten Geschicken vorbehalten, daß bei allen Völkern Verbindungen mit Juden stets als eine Art Frevel betrachtet worden sind. Wenn Sie durchaus die Frau eines, wenn auch konvertierten, Juden werden wollen, so haben Sie damit zu rechnen, einem tödlichen Fluche zu verfallen, und das sage ich Ihnen im Auftrag Gottes, trotz aller gegenteiligen Versicherungen feiger oder verblödeter Priester, von welchen Sie vielleicht sonst noch einen Rat verlangen könnten.‹“ (Hervorhebung im Orig.).
S. 408 zu 13.9.47 aquae… – neuer Kommentar: Als Veronica Schranz sich wegen einer Festschrift zum 65. Geburtstag ihres Vaters an Walter Warnach wandte, fragte dieser Schmitt, ob er dazu beitragen wolle, vielleicht mit einem Aufsatz über Konrad Weiß. In einem Brief vom 20.1.1959 antwortete Schmitt, Veronica Schranz sei für ihn kein Problem, aber „es handelt sich um den Siedlinghauser Kreis als solchen, der sich nach 1945 sehr fühlbar von mir distanziert hat und zu dem Leute wie Döderlein und Niekisch eher gehören als meine vogelfreie Wenigkeit. Ich bin aus Schranz nach 1945 nicht mehr klug geworden. Eine unbefangene Aussprache war nicht mehr möglich, trotz mancher freundlichen Gesten und einer zweiten gutmütigen Bereitschaft zur Nachsicht und Wohlwollen.“ (Veröff. in Vorber.). In ihren Erinnerungen an den Siedlinghauser Kreis schreibt Veronica: „Obzwar es in der Freundschaft C. S.s zu meinem Vater nie zu einem Bruch gekommen ist, war C. S. nach 1954 nur noch zu kurzen Besuchen in Siedlinghausen.“ (Schmittiana III, 1991, S. 77). Die Gegnerschaft gegen Schmitt kam demnach weniger von Schranz selbst, der nach dem Ende des Dritten Reiches, wie aus dem Briefwechsel Schmitts mit Duschka ersichtlich, unverändert zu Schmitt gehalten hatte, als vielmehr von Mitgliedern des Kreises, vor allem wohl von Josef Piper, mit dem Schranz enger befreundet war als mit Carl Schmitt.
S. 409 zu 21.9.47 Rosenbaum – letzten Satz streichen, stattdessen: Wenige Tage zuvor hatte Duschka ihrem Mann mit gleichlautender Formulierung geschrieben: „Nun muss ich Ihnen noch berichten, lieber Carl, über meinen Besuch bei Dr. Br. Am Mittwoch war ich von 1 – ½ 3 bei ihm; es war eine sehr interessante Unterhaltung. Etwa im April hatte er Besuch von Dr. Rosenbaum (ehemals Hamburg) aus London als engl. Offizier. Er hat von Eislers erzählt und ließ nichts Gutes an Ihnen. Ich erzähle Ihnen alles mündlich.“ Carl Schmitt / Duschka Schmitt, Briefwechsel 1923-1950. Hrsg. von M. Tielke, Berlin 2020, S. 301.
S. 412 zu 2.10.47 Blüher, Erhebung – nicht „die deutschen Güter“, sondern „die christlichen Güter.“
S. 414 zu 7.10.47 neu: der Ausspruch, den der Vater von Kierkegaard… – Der Vater hütete als Kind auf der jütischen Heide die Schafe und fühlte sich verlassen und unglücklich. In dieser Stimmung verfluchte er Gott, was ihn lebenslang belastete. Vgl. Peter P. Rohde, Kierkegaard (Rowohlts Monographien), Hamburg 1959 u. ö., S. 40-42.
S. 418 zu 21.11.47 neu: Zurückweichen der Naturschranke – bezieht sich auf Georg Lukács, Geschichte und Klassenbewußtsein, Berlin 1923, S. 243; vgl. TB III, S. 478.
S. 418 zu 24.11.47 neu: Lenins Schrift über den Radikalismus – Der genaue Titel lautet: Lenin, Der „Radikalismus“, die Kinderkrankheit des Kommunismus. Hrsg. vom Westeurop. Sekretariat der Kommunist. Internationale, Leipzig 1920 u. ö. In Schmitts Bibliothek befindet sich ein annotiertes Exemplar der Erstausgabe (RW 265 Nr. 26674).
S. 420 zu 5.12.47 neu: Die Amnestie gehört… – vgl. Carl Schmitt, Amnestie oder die Kraft des Vergessens (1949), jetzt in: SGN, S. 218-221.
S. 423 zu 21.12.47 neu: Carus: Goethes „Wohlgeborenheit“ – bezieht sich auf Carl Gustav Carus, Goethe. Zu dessen näherem Verständnis, Dresden o. J., S. 235 ff.
S. 423 zu 23.12.1947 Hegel – ergänzen: s. auch ders., Hamanns Schriften. Notiz zu Hamann. Hrsg. und mit einem Nachwort sowie einer Bibliographie versehen von Till Kinzel, Wien 2016.
S. 425 zu 2.1.48 You can’t go home again – nicht „einer Novelle“, sondern „eines Romans“.
S. 428 zu 2.2.48 Bryce – bezieht sich auf: James Bryce, Moderne Demokratien. Bd. 1-3. Übers. von Karl Löwenstein u. Albrecht Mendelssohn-Bartholdy, München 1923-1926.
Ebd. zu Ostrogorski – bezieht sich auf: Moisej Ja. Ostrogorskij, La démocratie et lʼorganisation des partis politiques, T. 1-2, Paris 1903.
Ebd. zu Roberto Michels – C. S. bezieht sich auf: Robert Michels, Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens (Philosophisch-soziologische Bücherei, 21), 2. verm. Aufl., Leipzig 1925 (RW 579 Nr. 1105). Briefe von Michels an Schmitt sind mit Kommentar veröffentlicht in: Piet Tommissen, In Sachen Carl Schmitt, Wien 1997, S. 83-112.
S. 429 zu „ein Helot der knirschend schlang…“ – recte: „Ein Helot der knirschend schlürft‘ in Sklavennot“.
S. 436 zu 9.3.48 Vialatoux – In seinem Buch kritisiert Vialatoux Hobbes als den Begründer des Totalitarismus und schreibt ihm die Vaterschaft für Bolschewismus, Faschismus, Nationalsozialismus usw. zu. Vgl. Schmitts Ablehnung in: SGN, S. 139-151 sowie in: Der Leviathan, 1938, S. 111, 113 (FN), wobei er sich zustimmend auf die Polemik von René Capitant bezieht, der den „individualistischen Charakter der Staatskonstruktionen des Hobbes“ hervorhebt.
S. 443 zu 30.4.48 Die kleine Schrift „Land und Meer“ – am Schluss ergänzen: „In den neueren Auflagen von Klett-Cotta (zuletzt 8. Aufl. 2016) findet sich das Zitat auf S. 34 f.
S. 443 neu zu 4.5.48 Wehrlos reiche Frucht der Jahre… – Anfang des Gedichts, das den „Christlichen Epimetheus“ von Konrad Weiß einleitet.
S. 447 neu zu 26.5.48 Lies irgendjemandem heute, 1948, folgende Sätze vor – Der von Schmitt zitierte Text stammt aus G. K. Chestertons Essay ‚The Sultan‘, in: ders. A Miscellany of Men, London 1912 u. ö.
S. 448 neu zu 4.6.48 auf Cicero hackten sie los, der große Theodor Mommsen an der Spitze – vgl. Theodor Mommsen, Römische Geschichte, Bd. 4, 5. Aufl., München: dtv 1993, S. 175, 211 f., 313, 316.
S. 455 neu zu 7.7.48: Einführung des Glaubens der Gottgläubigkeit – Der Nationalsozialismus drang auf die Bezeichnung „gottgläubig“ statt einer bestimmten Konfession; aber auch „konfessionslos“ sollte so ersetzt werden. Die Absicht war, die konfessionelle Gespaltenheit Deutschlands durch eine gemeinsame Staatsreligion zu ersetzen.
S. 455 zu 14.7.48 Herbert Guthjahr – Laut Eberhard von Medem hat Schmitt von der Spitzeltätigkeit Gutjahrs nie etwas erfahren.
Ebd. Walter Lippmanns… – Lippmann entwickelte eine Theorie der „Atlantic Community“, zu der er neben Amerika ebenso Großbritannien, Skandinavien, die Niederlande, Belgien, Frankreich, Spanien und Italien zählte. Schon im Ersten Weltkrieg plädierte er für den Kriegseintritt der USA, da Deutschland mit dem U-Boot-Krieg den „Highway“ der Welt gefährde. Vgl. W. Lippmann, Early Writings, New York 1970.
S. 457 zu 1.8.48 Monsieur Béguin – ergänzen: Béguin war auch Herausgeber von Léon Bloy und Georges Bernanos.
S. 458 neu zu 1.9.48 Cautio Criminalis des Fr. von Spee – Der Jesuit Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635) veröffentlichte erstmals anonym 1631 sein Buch gegen die Hexenverfolgung.
Ebd. zu Dahm – „nationalsoz.“ streichen.
S. 461 neu zu 11.11.48 Julien Green – Schmitt besaß die Erstausgabe des Romans: Julien Green, Léviathan, Paris 1929 (RW 265 Nr. 24477).
S. 462 neu zu 14.9.49 Klages und die Folgen – bezieht sich auf Ludwig Klages, Der Geist als Widersacher der Seele, Bd. 1-3, München 1929-1932 u. ö.
S. 465 neu zu 10.3.49 Leistungsraum – eine Prägung von Viktor von Weizsäcker in ders., Der Gestaltkreis. Theorie der Einheit von Wahrnehmen und Bewegen, Leipzig 1940, S. 102. Schmitt nimmt sie auf in „Völkerrechtliche Großraumordnung“, vgl. SGN, S. 319.
S. 465 neu zu 13.3.49 der arme Bernanos auf der Unesco-Bühne – Die Rede hielt Bernanos am 12. 9. 1946 im Rahmen der „Rencontres internationales de Genève“, auf Deutsch erschien sie 1947: Georges Bernanos, Welt ohne Freiheit, Wien 1947.
S. 466 zu 22.3.49 The trend… – Z. 3 nicht „in Anm. 141“, sondern „in Anm. 161“.
S. 468 zu 27.4.49 fame praesenti… – Z. 3 nicht Hobbes, De homine X,4, sondern X,3.
S. 470 zu 17.5.49 Kemp – ergänzen: Literaturwissenschaftler, der sich insbesondere auch mit dem Werk Theodor Däublers und Konrad Weißʼ beschäftigte und als Vermittler der französischen Literatur eine bedeutende Rolle spielte. Im Nachlass Schmitts liegen 32 Briefe und 3 Postkarten von Kemp aus der Zeit von 1949 bis 1980.
S. 471 zu 17.6.49 Homer Lea – nicht: „sagte 1912 den Untergang des britischen Empire voraus“, sondern „… (1912) beschäftigt sich mit der Gefährdetheit des britischen Empire.“
S. 472 zu 23.6.49 Estrada-Doktrin und Bogota-Charter – Die von dem mexikanischen Außenminister Genaro Estrada Félix benannte, 1930 formulierte Estrada-Doktrin besagt, dass jede Anerkennung eines Staates eine völkerrechtswidrige Einmischung in die inneren Angelegenheiten dieses Staates ist. – Der offizielle Name der Bogota-Charter lautet: „Charter of Organization of American States“ (OAS). Der Artikel 9 lautet: „The political existence of the State is independent of recognition by other States. Even before being recognized, the State has the right to defend its integrity and independence, to provide for its perservation and prosperity, and consequently to organize itself at it sees fit, to legislate concerning its interests, to administer its services, and to determine the jurisdiction and competence of its courts. The exercise of this rights is limited only by the exercise of the rights of other States in accordance with international law.“ Mit der Charta verbunden war der am gleichen Tag (30.4.48) geschlossene Bogota-Pakt, der ein System kollektiver Sicherheit bieten sollte, jedoch wegen zahlreicher Vorbehalte einiger Staaten nur von wenigen ratifiziert wurde.
S. 472 zu 2.7.49 Carrion-Comfort – neuer Kommentar: Titel eines Sonetts des englischen Dichters Gerard Manley Hopkins. „Carrion“ definiert das Oxford English Dictionary folgendermaßen: „Dead putrefying flesh of man or beast; flesh unfit for food, from putrefaction or inherently“. Schmitt dürfte das Gedicht kennengelernt haben durch den Aufsatz von Irene Behn, Gerard Manley Hopkins und seine Dichtung, in: Hochland 32/2, 1935, S. 148-169. Hier findet sich auch eine Übersetzung des Sonetts, dessen Titel die Übersetzerin mit „Leichen-Labsal“ wiedergibt. Irene Behn gab 1948 in Hamburg bei Claassen & Goverts eine Auswahl der Gedichte von Hopkins heraus. Über den wenig bekannten Hopkins befindet sich in der Bibliothek Schmitts ein Sonderdruck von Friedhelm Kemp aus: Hochland 41, 1948/1949, S. 385-389, wo Kemp dessen Werk als das eines „schwierigst zugänglichen Dichters“ bezeichnet.
S. 473 zu 8.7.49 Wiener Emigranten namens Karpfen – am Ende ergänzen: Die Kritik von Bernanos an Carpaux ist auch auf Deutsch erschienen in: G. Bernanos, Gefährliche Wahrheiten, Augsburg/Basel [1953], S. 163-169.
Ebd. neu: Wie antwortet nun der alte Drumont-Biograph… – Bernanos hat keine Biographie des antisemitischen Pamphletisten Édouard Drumont (1844-1917) geschrieben, ihn jedoch in seinem Buch „La Grande Peur des Bien-pensants“ (Paris 1931) ausführlich und bewundernd gewürdigt.
S. 475 zu 4.8.49 Kirchheimer – Kirchheimer, während des Zweiten Weltkrieg im U.S. Office of Strategic Services (OSS) tätig, besuchte Schmitt 1949 und 1953 in Plettenberg; s. Carl Schmitt / Duschka Schmitt, Briefwechsel 1923-1950, Berlin 2020, S. 346.
S. 475 zu 20.8.49 Mioriţa-Schicksal – vgl. Mircea Eliade, Von Zalmoxis zu Dschingis Khan. Religion und Volkskultur in Südosteuropa, Frankfurt a. M. 1990; darin S. 235-267: „Das weissagende Lämmchen“.
S. 480 zu 26.11.49 Exposé des R. P. Bruckberger – vgl. dazu den Briefwechsel Schmitts mit Walter Warnach (Veröff. in Vorber.). Warnach übersetzte: Raymond-Léopold Bruckberger, Die Kosaken und der Heilige Geist, Karlsruhe 1952.
S. 481 zu 24.12.49 Hamburger Urteil gegen den deutschen General Manstein – zur Problematik s. F. J. P. Veale, Der Barbarei entgegen, Hamburg 1954, S. 252-268. Der englische Jurist und Historiker Veale (1897-1976) benannte als einer der ersten Kriegsverbrechen der Alliierten. Von ihm liegen 107 Briefe und sechs Postkarten im Nachlass Schmitts.
S. 485 zu 23.5.50 Vanini-Ode Hölderlins – nicht „Lucilio Vanini“, sondern „Giulio Cesare Vanini“.
S. 486 zu 15.6.50 Mit Mühe und Umständen… – Scheibert (1905-1995) war 1949/50 bei der Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft für das Bibliothekswesen zuständig und bereiste in dieser Funktion die USA. Von ihm gibt es 36 Briefe, 14 Postkarten und 3 Telegramme im Nachlass Schmitts.
S. 502 zu 18.5.52 Dio Chrysostomos… – in Z. 6 nicht „Ester“, sondern „Esther“.
S. 502 zu 13.7.52 Großartig, was Günther Krauß sagt – Die Habil.-Schrift von Krauß hatte nicht den Titel „Homo homini homo. Zwölf Kapitel zur Relectio de Indis“, sondern: „Christentum und Humanismus im Völkerrecht“.
S. 521 zu 23.11.55 Caux – ergänzen: „… der Moralischen Aufrüstung, die in den 50er Jahren in Deutschland besonders aktiv war.“ Vgl. Frank N. Buchmann, Für eine neue Welt. Gesammelte Reden, Caux 1961.“
S. 521 zu 19.12.55 ein giftiger Morghenthau-Typ – nicht „Die Bösartigkeit…“, sondern „Das Bösartige…“.
S. 526 zu 4.10.56 Bitten Sie doch Herrn Kranzbühler – ergänzen: Vgl. Otto Kranzbühler, Rückblick auf Nürnberg, Hamburg 1949.
S. 530 f. zu 17.8.57 Herrlich dagegen Hans Freyer… – Die Geburtstagsrede Gehlens erschien unter dem Titel: Ein wahrhaft lebendiger Geist. Zum 70. Geburtstag Hans Freyers, in: FAZ vom 2. 8. 1957. Vgl. auch Carl Schmitt, Die andere Hegel-Linie. Hans Freyer zum 70. Geburtstag, in: Christ und Welt vom 25.7.1957.
S. 531 neu zu 6. 10. 57: Connoisseur of Chaos – Titel eines Gedichts von Wallace Stevens.
S. 534 zu 25.8.58 Quevedo – Das Wort „Monopantes“ hat Quevedo vermutlich aus den griechischen Worten „monos“ (einzig) und „pante“ (überall) gebildet. Der Übersetzer der deutschen Ausgabe von 1966 (Frankfurt: Insel Verlag), Wilhelm Muster, erläutert: „Quevedo meint Menschen, die, gering an Zahl, überall zu spüren sind und alles durchdringen.“ (S. 347).
S. 536 neu zu 30.12.58 „das waren Deine Glocken nie“ – aus dem Gedicht „Venus Religio“ von Richard Dehmel (1863-1920).
S. 538 zu Borgese – Borgese (1882-1952) Dichter, Litarurhistoriker und politischer Schriftsteller; Schwiegersohn von Thomas Mann.
S. 538, zu Just – am Ende ergänzen: vgl. Christian Tilitzki, in: Schmittiana VII, 2001, S. 299 f., Fußnote 76, wo die Titel des Ost-Experten Just genannt und eingeschätzt sind.
Stand 5.12.2020
Carl Schmitt. Die Militärzeit 1915 bis 1919. Tagebuch Februar bis Dezember 1915. Aufsätze und Materialien, hrsg. von Ernst Hüsmert und Gerd Giesler. Akademie Verlag, Berlin 2005
S. VII, 10.Z., neue Anmerkung: „Die Türkenkaserne war eine Kasernenanlage in der Maxvorstadt, sie wurde im II. Weltkrieg zerstört, heute befinden sich auf dem Gelände die Pinakothek der Moderne, das Museum Brandhorst und andere Bauten.
S. VII, 1. Abs., vorletzte und letzte Zeile entfallen ersatzlos
S. VIII, 1. Z.: Am Ende neue Anm. einfügen: Carl Schmitt hat entgegen der hier aufgestellten Behauptung zumindest im Jahr 1920 Tagebuch geführt. Am 10. Juli 1927 notiert er: „Den ganzen Tag gearbeitet an meiner Verfassungslehre, las nach den Tagebüchern von 1920, vor 7 Jahren, als ich die Diktatur schrieb. Das gab mir Mut. Welch schauerlicher Zustand damals …“ Und am 15. August 1927 notierte er: „… Tagebücher aus dem Jahr 1917 gelesen …“
S. X, 9. Z. v.u.: korrekt „Frieden oder Pazifismus?“ statt „Frieden oder Pazifismus“.
S.7, letzte Z.: nach Kollmann einfügen: „ ,der Kulturphilosoph Otfried Eberz“
S. 8, letzter Abs., 6.Z.v.o., neue Anm. nach Straßburg: „In dem Brief vom einen 28.01.1978 an Hans Blumenberg erwähnt Carl Schmitt sein Habilitationskolloquium im Februar 1916, das der ‚alte Gold-Entthroner‘ Georg Friedrich Knapp leitete.“
S. 9, letzter Abs., 4. Z. v.u., Ergänzung: „und der Mitarbeit an Calkers ‚Grundriss des Strafrechts“. Fritz von Calker Grundriss des Strafrechts. J Schweizer Verlag (Arthur Sellier), München und Berlin 1916, in dessen Vorwort sich der Verfasser bie Carl Schmitt herzlich bedankt.“
S. 15, Anm. 65, letzte Z., Ergänzung: Abgedruckt in MWG III.6 Anhang II, S. 529-533; Max Weber an Else Jaffé, Brief v. 15.4.1920, MWG III. 7, S. 50
S. 15, Anm. 66, ab 4. Z. v.o.: korrekt „Janentzki“ statt „Janowski“; korrekt „Clausing“ statt „Klensing“.
S. 16, 3. Abs., 1.u.2. Z., Korrektur und Ergänzung. „Als Hugo Ball 1919 in München durch eine bekannte Eduard Bernsteins Carl Schmitt kennenlernt und mit ihm Gespräche über französische Neukatholiken (Hello, Bloy, d’Aurevilly) führt, sieht er den Schriftsteller zum ersten Mal, der in…“. Siehe dazu den Eintrag in Hugo Balles Tagebuch XXX.
S. 16, letzter Abs., 7. Z. v. u., Ergänzung: Todfeind „der“ Romantik
S. 35, Anm. 27, letzte Z.: korrekt „5 Jahren Gefängnis“ statt „4 Jahre Gefängnis“
S. 39, Anm. 32, Ergänzung; Siehe auch Heike Biedermann. Ida Bienert – Avantgarde als Lebensgefühl, in: Von Monet bis Mondrian. Meisterwerke der Moderne aus Dresdner Privatsammmlungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, hrsg. von Heike Biedermann, Ulrich Bischoff, Matthias Wagner. Deutscher Kunstverlag, Berlin 2000, S. 69-80. Ida Bienert hatte 1918 Picassos ‚La Dame au Chapeau noir‘ (1909/10) durch Vermittlung von Däubler an Schmitts Jugendfreund Franz Kluxen verkauft.
S. 40, Anm.33, 2.Z., Einfügung: „2. Aufl., sowie korrekt „minderen“ statt „minderer“
S.56, Anm. 66, 2. Z., Einfügung: „2. Aufl., S. 65
S. 91, Eintrag 8. Juli, 6.Z.v.o.: korrekt „Hausenstein“ statt „>Hausentein<
S. 92, Anm. 117, Einfügung am Ende: „Die beiden Briefe von Carl Schmitt an Rathenau sind abdruckt in Walther Rathenau, Briefe. I: 1871–1913. Hrsg. Von Alexander Jaser, Clemens Picht und Ernst Schulin. Droste, Düsseldorf 2006, S. 1079f., 1083f.
S. 105, Anm. 131: korrekt „Rechtsphilosophie“ statt „Rechtsphilosphie“
S. 112, Eintrag 13. Februar, 2. Z.v.o.: nach Schaetz neue Anm.:“Carl Schmitt widmete ihm seine Abhandlung ‚Der Begriff des Politischen‘. Dem Andenken meines Freundes August Schaetz aus München gefallen am 28 August 1917 beim Sturm auf Moncelul“.
S. 134, Anm. 165, Ergänzung: den Roman „Die Zauberflöte“, 1916
S. 159, Ergänzung: Hermann Rehm (1862-1917), Jurist
S. 171, 5.Z.v.o.: korrekt „Treitschke“ statt „Treischke“
S. 175, 5.Z.v.u.: korrekt „Juli“ statt „Juni“
S. 177, 3. Abs., 1. Z.: korrekt „Männern“ statt „Männer“
S. 184, 1. Abs. 5.Z.v.u., Ergänzung: Seit Dezember 1918 war Sonnenburg in der Regierung Eisner Regierungskommissar für die bayerische Staatszeitung; er wurde am Ende seines Lebens ein engagierter Pazifist
S. 185, nach 3. Abs. neuer Abs.: „Die Pressebesprechung im Mai 1918 (siehe Exkurs, S. 393) gibt einen Überblick über die Auswirkungen der Friedensbewegung in der Schweiz, die sich einen Schauplatz im Kampf der Propagandisten der kriegführenden Staaten entwickelt hatte“
S. 188, Dokument 25: korrekt „antisemitischen“ statt „antisemtischen“
S. 262, Legende, vorletzte Z.: korrekt „Stv. Gen. Kdo. I. b. AK“ statt „Mkr“
S. 361, Legende 2.Z.v.o., Ergänzung: nach Kolbs Aktivitäten „siehe Christian Kennert, Paul Cassirer und sein Kreis. Ein Berliner Wegbereiter der Moderne. Peter Lang, Frankfurt a. M. 1996, S.136 und“
S. 376, Legende, 1.Z: korrekt „S. 898“ statt „S. 400“
S. 387, 2.Z.v.o., Ergänzung: tätig war, „ab 1917 sich auch pazifistisch engagierte“:
S. 388, Legende, 2.Z.v.o., Ergänzung: haben soll. „Zu Klabunds Tätigkeiten während des I. Weltkriegs siehe Markus Pöhlmann, Der Grenzgänger. Der Dichter Klabund als Propagandist und V-Mann des Ersten Weltkriegs, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 55 (2007), H. 4, S. 397- 410
S. 395, Anm. 6, 4.Z.v.u., Korrektur und Ergänzung: geleitet vom Deutschlandkenner „Francois Émile Haguenin (1872-1924), der vor dem Krieg Gastprofessor an der Berliner Fakultät der FWU war“.
S. 403, Vorspann, 7.Z.v.o., Ergänzung: „Hierzu zählen vor allem Zeitungen ‚El Imperial‘, ‚Daily Mail‘, ‚Excelsior‘, ‚L’homme enchaîné, ‚L’Humanité und ‚Independent Belge‘, die die Kaiserlich-Deutsche Gesellschaft zu Berlin schickte (siehe Korol, S. 216)
S. 430, 1.Z., Ergänzung: „ Summa“ war; was der scholastische Name andeutet, eine katholisch grundierte Zeitschrift…
Ende des Absatzes, Ergänzung: „Zur Zeitschrift im Allgemeinen und speziell zum Verhältnis der beiden Mitarbeiter Carl Schmitt und Robert Musil siehe Wolfgang Fietkau, Stand-Ort und Un-Ort. Wissenschaftserkenntnis in der literarischen Transkription Robert Musils und Carl Schmitts. Wissenschaftskolleg. Jahrbuch 1982/83, hrsg. v. Peter Wapnewski, Berlin 1983, S. 131-152.“
S. 473, Ende des Textes, Ergänzung: „In der ‚Fackel‘ XXIV. Band, Heft 601 – 607 vom November 1922 attackiert Karl Kraus auf Seite 84 – 90 Franz Blei wegen dieses Beitrags.“
S. 474, Vorspann, 5. Z.: korrekt „Jacobi“ statt „Jakobis“
S. 481, 2. Abs., 2. Z.: korrekt „M. de Malestroit“ statt „M. de Malestroif“
S. 505, Brief Kiener an Schmitt, 3. Z.v.o., Ergänzung: „Alexander Cartellieri, Autor des Werkes „Weltgeschichte als Machtgeschichte“, 5 Bde., 1927.“
S. 508, Anm. 37: korrekt „474“ statt „74“
S. 513, Verfasser des Briefes: korrekt „Moesle“ statt „Moerle“. Stephan Moesle (1874-1951)
S. 521, Vorspann, 1. Z., Ergänzung: „Alice Berend (1875-1938), Autorin einiger Erfolgsromane und Schwester der Malerin Charlotte Berend-Corinth, …“
S. 365, Dokument 38, 2.Z.: korrekt „A. H. Fried“ statt „G.A. Fried“
S. 575, Eintrag Bonn, Moritz Julius: korrekt „So macht man Geschichte?“ statt „So macht man Geschichte“
S. 575, neuer Eintrag: Creutz, Martin. Die Pressepolitik der kaiserlichen Regierung während des Ersten Weltkriegs. Die Exekutive, die Journalisten und der Teufelskreis der Berichterstattung Peter Lang, Frankfurt a. M. 1994, 315 Seiten.
S. 577, neuer Eintrag: Korol, Martin. Deutsches Präexil in der Schweiz. 1916 bis 1918. Hugo Balls Dadaismus und Ernst Blochs Opposition von außen gegen die deutsche Politik in der Schweiz während des Ersten Weltkriegs, Bremen 1999.
S. 577, neuer Eintrag: Pöhlmann, Markus. Der Grenzgänger. Der Dichter Klabund als Propagandist und V-Mann des Ersten Weltkriegs. Zeitschrift für den Geschichtswissenschaft 55. Jg. (2007), H. 4, S. 397-410.
S. 386, korrekt „Schaetz 126-128 statt „126,128“
Strohmeyer, Arnim: korrekt „362“ statt „361“
Briefwechsel Ernst Forsthoff – Carl Schmitt (1926 – 1974), hrsg. von Dorothee Mußgnug, Reinhard Mußgnug und Angela Reinthal in Zusammenarbeit mit Gerd Giesler und Jürgen Tröger, Akademie Verlag, Berlin 2007.
S. 6, Anm. 6, Z. 1f.: nicht „Durch seine Prozessvertretung für das Land Preußen“, sondern „…für die SPD-Fraktion im Preußischen Landtag“
S. 13, Abs. 2, Z: 6.v.o.: nicht Grablege „des Königs“, sondern „des Kaisers“
S. 65, Abs. 2, Z. 4 v.o. sowie S. 374, Kommentar Nr.
32/5, Z. 4, 5 und 10 v.o. und S. 589, Register: nicht „Steininger“, sondern „Steiniger“
S. 356, Kommentar Nr. 8/1: nicht „Der Begriff des Politischen, 1928“, sondern „Der Begriff des Politischen 1932. Diese Ausgabe wurde bereits im November 1931 ausgeliefert“
S. 374 Kommentar zu Nr. 32/5, Z. 5 v.o. ergänzen: „Steiniger hatte 1928 bei Hensel und Schmitt promoviert, im 3. Reich lebte er in Berlin als Lektor und verfasste unter dem Pseudonym ‚Peter A. Steinhoff‘ historische Romane (u.a. ‚Der Schatten Gottes‘), ab 1939 bis 1944 in einem Bankhaus tätig, bis 1945 illegal in Schlesien…“
S. 419, Kommentar Nr. 97/2, Z. 2 v.o. und Register
S. 585: nicht „Friedrich von Menger“, sondern „Friedrich Menger“
S. 556.Titel ergänzen: 1941. Rezension zu Carl Schmitt, Der Leviathan…, in: Zeitschrift für deutsche Kultur, Philosophie. NF des Logos, Bd. 7 (1941), S. 206-214
S. 558, letzter Eintrag 1960: nicht „Merkur 14“, sondern: „151“
S. 578, Eintrag Beyerle: 364 statt 363
Carl Schmitt – Briefwechsel mit einem seiner Schüler
Herausgegeben von Armin Mohler in Zusammenarbeit mit Irmgard Huhn
und Piet Tommissen, Akademie Verlag, Berlin 1995.
(Aufstellung vorhanden, wird auf Nachfrage geschickt)
S. 45, 4. Abs., 3. Z. nicht Paetel, sondern Pechel
S. 102, 1. Abs., 6. Z. nicht invicibilis, sondern invincibilis
S. 115, 4. Abs., 2. Z. nicht NWR, sondern NWDR
S. 122, 1. Abs., 3. Z.v.u. nicht Petrus, sondern Patras
S. 128, 2. Abs., 2. Z. Auflösung <…>: Dass ich ihm die Bibliographie zeigen werde, brauchen Sie nicht zu befürchten.
S. 129, 3. Abs., 5. Z.v.u. Auflösung <…>: Etwas anderes ist natürlich die Methode unseres Bibliographico. Übrigens ist seine Bibliographie wirklich grossartig und, soviel ich sehe, vollständig bis Juni 1952. Nur das Ausland ist sehr unvollständig.
S. 135, 2. Abs., 2. Z. nicht Wäterlin, sondern Wälterlin
S. 137, letzte Z. Auflösung <…>: Noch nicht einmal über den Besuch des Freiherrn von Schrenck-Notzing habe ich Ihnen berichtet. Er war am 13. Februar hier zu Besuch, wurde gut bewirtet, trank den besten Wein, wischte sich den Mund und liess nichts mehr von sich hören.
S. 141, 1. Abs., 2.Z. Auflösung <…>: Neske
S. 178, 7. Z. nicht Matan, sondern Mahan
S. 187, Anm. 220. Am Schluss anfügen: Gadamer hatte zu der im Verlag K. F. Koehler erschienenen Autobiographie „Denken“ 1957 eine Einleitung verfasst.
S. 194, 3. Strophe, 1. Vers, nicht entsperrt, sondern entsperrt
S. 212, Ziffer 1, 3.Z. nicht Boehlhaus, sondern Böhlaus
S. 217, 3.Z.v.u. nicht Librairie Général, sondern Librairie Générale
S. 271, Brief 227, Rainer Specht (geb. 1930), Philosoph
S. 272, 1. Abs., 4. Z. Auflösung <…>: Die Fragen Hepps sind etwas subaltern; wie lange ist er eigentlich schon katholisch? Seine Angst vor dem Verfassungsschutz ist rührend. Er soll sich, wenn er aktiv werden will, lieber erst einmal über den Begriff und die Praxis der »potestas indirecta» erkundigen, ehe er integrale Politik macht.
S. 282, 4. Vers v. u. nicht Unglückstracht, sondern Unglücksfracht
S. 285, Gedicht im Brief Das Gedicht bezieht sich auf die Angriffe von Prof. Adolf Schüle Mai 1960 zur 1959 veröffentlichten Festschrift für Carl Schmitt. Siehe Briefwechsel E. Forsthoff – C. Schmitt, Berlin 2005, S.79-84.
S. 290, 5. Zeile nicht Kurt, sondern Kunrat, so wie in Anm. 350 genannt.
S. 300, Gedicht, 3. Vers nicht modernen, sondern modernden
S. 300, 2. Abs., 4.Z. Auflösung <…>: Den Brief, den Sie der Verehrerin in D: Lohrer geschrieben haben, ist gut und treffend, aber die Antwort, die Weinrich im Zeit-Archiv mitteilt, beweist die Fruchtlosigkeit solcher Diskussionen.
S. 301, Anm. 361, 3. Satz. Statt des gedruckten muss er neu lauten: 1983 hat Carl Schmitt Prof. Joseph H. Kaiser testamentarisch zum Testamentsvollstrecker für den wissenschaftlichen Nachlass eingesetzt.
S. 302 Schnabel-Gedicht:
Es saugt der Schüler Wort für Wort
vom Schnabel des Professors fort.
In Zeiten historischer Zersetzung
bereitet Einfalt uns Ergötzung.
Drum sei für sie ein neues Jahr,
was Schnabel lehrt, auch wieder wahr.
Franz Schnabel (1887-1966), Historiker, 1922 Prof. in Karlsruhe, 1936 Entlassung aus pol. Gründen, 1945 erneut Karlsruhe, ab 1947 München, Hauptwerk: Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert, 4 Bde., Freiburg 1929/37
S. 305. Bei der Kopie eines Manuskriptes von C.S. handelt sich um einen von Carl Schmitt unter Pseudonym Dr. Ivo Schütz an die „Deutsche Zeitung“ geschickten Leserbrief.
S. 308, Brief Nr. 263, 6.Z.v.o. Auflösung <…>: Laufer
S. 309, 2. Z. Auflösung <…>: Laufer
S. 309, 14. Z. Auflösung <…>: Pattloch
S. 309, 5. Z.v. u. Auflösung <…>: Carl Muth
S. 310, 1. Abs., 1.Z. Auflösung <…>: Laufer
S. 314, Anm. 370. Der letzte Satz muss ausgetauscht werden gegen folgendem: Die „Kaltenbrunner-Berichte“ sind die Vernehmungsprotokolle der Attentäter des 20. Juli 1944, die Kaltenbrunner für Hitler zusammenstellte und die 1961 unter dem Titel „Spiegelbild einer Verschwörung“ veröffentlicht wurden.
S. 322, Anm. 393. Die Erstauflage des Buches von J. Fijalkowski ist 1957 erschienen.
S. 336, Ziffer 2, 2. Z. nicht Gross, sondern Groh
S. 364, 1. Abs., 8. Z. nicht Otto Friedrich, sondern Otto Friedrich Flick, ältester Sohn des Konzerngründers Friedrich Flick.
S. 370, Anm. 1 nicht „Wir alle lügen“, sondern „Wir lügen alle“
S. 380, 6. Z. v.o. nicht Unescu, sondern Unesco
S. 389, 1. Abs. 6. Z. nicht Adlei, sondern Adlai
S. 408, 3. Z. Auflösung <…>: und auch Tommissen noch nicht nenne
S. 408, 7. Z. Auflösung <…>: Was Ihre Freunde vom Criticon und vor allem auch Sie selbst sich gedacht haben, als sie Tommissens Aufsatz über den Renouveau Catholique in Deutsch veröffentlichten mit all seinen sprachlichen, gedanklichen und fachlichen Ungenauigkeiten, Fehlern, Lücken, Schiefheiten etc., ist mir ein Rätsel, doch muss ich das Ihnen und Ihren Freunden überlassen.
S. 408, 10. Z. Auflösung <…>: Haben Sie das Buch von Tommissen »Over en in zake Carl Schmitt» erhalten? Teilen Sie mir doch bitte Ihren Eindruck davon mit, als Freundschafts-Hilfe, weil ich das nicht mehr verstehe und gelernt habe, Bibliographie von Biographie zu unterscheiden.
S. 410, 3. Z.v.o. Der Hinweis bezieht sich auf die Biographie von Heinz Hürten, Waldemar Gurian. Ein Zeuge der Krise unserer Welt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Mainz 1972
S. 423, 2. Z.v.o. Alexander Kluge hatte zu Carl Schmitts 90. Geburtstag eigens eine neue Figur, ‚den letzten Schüler des Verfassung-Schmitt‘ erfunden, ‚um die Menschheit vom Nazismus zu erlösen‘. Alexander Kluge, Unheimlichkeit der Zeit. Neue Geschichten. Hefte 1–18, es 819, Suhrkamp, Frankfurt a.M., 618 Seiten. Heft 16, S. 528f.
S. 424, Brief Nr. 389, letzte Zeile Zitat aus „Trostaria“ von Johann Christian Günther, vgl. Anm. 312.
S. 426, 2. Abs., 1.Z. Der Artikel zu Niekisch von Armin Mohler erschien in „Criticon“, Nr. 59, Mai/Juni 1980
S. 432, Ziffer 5, 2.Z.v.u. nicht herablassen, sondern herabzulassen
Nach Veröffentlichung des Briefwechsels aufgefundene Briefe/Karten
Nr. 340a
AK/hs
[o.O., 7.3.67]
Mein lieber Arminius, ich mache es Ihnen leicht und bitte Sie nur, die beil. Postkarte auszufüllen (Sendezeit und Sender), damit ich Winfrid Martini hören kann. Im »Handelsblatt» lese ich, dass kein Schweizer Vertreter bei Ihrer Dankrede anwesend war; aus Ihrer Dankrede (vielen Dank!) entnehme ich, dass der Schweizer Konsul anwesend war. Offenbar ist ein neuralgischer Punkt getroffen. Den (üblen) Aufsatz im Handelsblatt (6/3/67) hat ein Redaktionsmitglied namens Fritz Hufer geschrieben; ich höre den Namen zum ersten Mal. Hat Ihnen Hans Fleig gratuliert? Ich werde mir Donnerstag die »Zeit» kaufen (»hier bedient Sie eine echte Gräfin»), was ich sonst nicht tue, um mal zu sehen oder hören, ob es dort wieder mal »geklingelt» hat.
Herzlich Ihr alter C.S.
Nr. 340b
B/hs Plettenberg
28/3/67
Mein lieber Arminius: an jedem Tag dieser letzten Woche (seit dem 16. März, an dem ich Ihren Brief aus Wiessee erhielt) wollte ich Ihnen schreiben, aber vieles hat mich gelähmt, am meisten der Anblick der lahmen »Rechten», die Ehre und Preise verteilen, ohne den von ihnen Geehrten zu verteidigen. Der Frhr. von der Heydte ist da wirklich eine überraschende Ausnahme. Nicht die biereifrigen Entrüstungsakrobaten von Links, sondern die Preis- und Spielverderber von rechts sind es, die man näher betrachten muss. Ich erinnere mich an die blamable Figur, die der traurige Heinrich von Brentano s. Zt. im Bundestag machte, als er es gewagt hatte, anzudeuten, dass Bert Brecht »engagiert», politisch engagiert war, ein bedenkenswerter Vorgang, an den auch Johannes Gross in seinem neuen Buch »Die Deutschen» S. 256 erinnert, und zwar unter der Überschrift: Macht und Geist. Hier bricht so vieles in mir auf, dass ich besser verstumme. Capisco et obmutesco.
An Ihrer Stelle, lieber Arminius, hätte ich keine gerichtliche einstweilige Verfügung beantragt. Hier ist für Sie und Ihre Freunde noch vieles zu lernen; vgl. die Glosse 5 auf Seite 109 meiner Verf.rechtlichen Aufsätze von 1958 (besitzen Sie das Buch? Ich schicke es Ihnen gern als Ostergeschenk). Dass ich Ihnen dergleichen schreibe, dürfen Sie nicht falsch verstehen. Ich meine, Sie dürfen sich die Fragen nicht von der Meute stellenlassen. Sie sind jetzt Privatdozent und Ihr Stil (auch der Ihres behaviour) wird dadurch bestimmt. Wichtiger als alles andere ist Ihre nächste wissenschaftliche Publikation.
Hoffentlich haben Sie sich in Bad Wiessee gut erholt. Was Sie mir von Ihrer Frau berichten, hat mich begeistert; ich hatte es aber auch nicht anders erwartet. Schade, dass meine gute Frau Duska diesen Puppentanz nicht erlebt hat. Grüßen Sie Edith herzlich von mir; auch Winfried Martini und seinen Sie selber vielmals gegrüsst von Ihrem alten und getreuen
Carl Schmitt